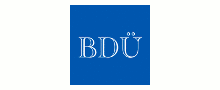Liebe Leserinnen und Leser,
in dem nachfolgenden Erbrecht ABC werden Ihnen in alphabetischer Reihenfolge die wichtigsten Begriffe aus dem Erbrecht erläutert.
Hierbei bitten wir zu berücksichtigen, dass wir uns im Sprachgebrauch bewusst einfach gehalten haben, um in erster Linie den interessierten Laien näher an die geltenden regeln im Erbrecht heranzuführen.
Vor diesem Hintergrund dient das Erbrecht ABC in erster Linie dazu, sich allgemein über die wichtigsten Begriffsbestimmungen im Erbrecht informieren zu können.
Im Hinblick auf die Tragweite der zu treffenden Entscheidungen und auch im Hinblick auf das Vermögen, das es rechtssicher zu vererben gilt, sollte vor Errichtung eines Testamentes oder einer letztwilligen Verfügung immer auch erst der Rechtsrat durch einen kompetenten Rechtsanwalt, Notar, und bei größerem Vermögen auch durch einen Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht, herangezogen werden.
Entsprechend kompetente Berater hierfür finden Sie in unserer Homepage unter „Expertensuche“ auch in der Nähe Ihres Wohnsitzes.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beim Lesen viel Spaß.
Ihr
Martin Weispfenning
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
A
Ablieferung eines Testamentes
Hat jemand ein privatschriftliches Testament errichtet, so ist derjenige, der es findet oder im Besitz hat, verpflichtet, es unverzüglich, nachdem er von dem Tode des Testamentserrichters (Erblassers) Kenntnis erlangt hat, an das Nachlassgericht abzuliefern.
Bei Nichtablieferung oder Unterdrückung des Testaments kann sich der Testamentsbesitzer strafbar und schadensersatzpflichtig machen, wenn er dadurch Ansprüche von Bedachten unterdrückt.
Alleinerbe
Als Alleinerbe wird diejenige Person bezeichnet, die aufgrund der alleinigen Erbeinsetzung in einem Testament oder aufgrund gesetzlicher Erbfolge einen Verstorbenen, gesetzlich „Erblasser“ genannt, allein ohne das Vorhandensein weiterer Erben beerbt.
Damit tritt der Alleinerbe die alleinige Rechtsnachfolge in das gesamte Vermögen des Erblassers an, jedoch auch in seine Verbindlichkeiten.
Alleintestament
Nachfolgend finden Sie das Muster eines einfachen Alleintestaments, also von einer Person, bei deren privatschriftlichen Errichtung die Form zu beachten ist. (Siehe hierzu: Eigenhändiges Testament)
MUSTER
Mein letzter Wille (oder)
Mein Testament
Zu meinem alleinigen Erben setze ich hiermit meine Tochter Anke
Mustermann, geborene Müller, wohnhaft in ______________, ein.
Ort, Datum, Unterschrift
Amtliche Verwahrung eines Testamentes
Ein privatschriftlich errichtetes Testament kann überall aufbewahrt werden, sei es zu Hause oder in einem Banksafe. Sie können es auch einer Vertrauensperson überlassen, z. B. der Person, die Sie als Erbe eingesetzt haben.
Falls Sie ganz sicher gehen wollen, dass mit Ihrem Testament nach Ihrem Ableben auch das Richtige passiert, sollten Sie dieses bereits zu Lebzeiten in die sogenannte „besondere amtliche Verwahrung“ beim Nachlassgericht des nächstgelegenen Amtsgerichts geben. Die Herausgabe des Testaments, z. B. wenn Sie es ändern oder zurücknehmen wollen, können Sie jederzeit verlangen. Bei gemeinschaftlichen Testamenten, also durch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, müssen jedoch beide Ehegatten oder Lebenspartner erscheinen.
Der Vorteil einer „besonderen amtlichen Verwahrung“ besteht darin, dass das Nachlassgericht die Testamentseröffnung nach Ihrem Tode „automatisch“ in die Wege leitet, da es vom Sterbestandesamt über Ihr Ableben informiert wird.
So können Sie sicherstellen, dass das nach Ihrem Tode aufgefundene Testament nicht durch Nichtbedachte „verschwindet“ und der eingesetzte Erbe auch tatsächlich die Erbschaft erhält.
Vor einem Notar errichtete Testamente müssen immer bei Gericht hinterlegt werden.
Anfall der Erbschaft
Nach den gesetzlichen Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geht mit dem Tode einer Person deren Vermögen als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen über. Damit fällt dem oder den Erben die Erbschaft an, unbeschadet des Rechts, die Erbschaft auszuschlagen. (Siehe Kapitel: Erbausschlagung)
Annahme der Erbschaft
Die Erbschaft durch den oder die Erben gilt als angenommen, wenn die Erben die Annahme der Erbschaft ausdrücklich erklären oder wenn die für die Ausschlagung der Erbschaft vorgeschriebene Frist – in der Regel sechs Wochen nach Kenntnis des Todes und des Erbanfalls – verstrichen ist. Da die Annahme der Erbschaft in den wenigsten Fällen ausdrücklich erfolgt, reicht hierfür auch „konkludentes“ Handeln aus, z. B. in dem Sie über die Erbschaft oder Erbmasse verfügen.
Vergewissern Sie sich daher vor der Verfügung über einzelne Erbanteile oder Gegenstände, dass der Nachlass nicht vielleicht überschuldet ist, da Sie durch die Annahme der Erbschaft auch in die Verbindlichkeiten, sprich „Schulden“ des Erblassers, eintreten.
Sollte dies der Fall sein, lassen Sie sich unbedingt von einem kompetenten Rechtsanwalt/Rechtsanwältin beraten, die Sie über unsere Expertensuche finden.
Auflage im Testament
Mit einer Erbeinsetzung, aber auch einer Vermächtniseinsetzung, in einem Testament können Sie auch eine Auflage verbinden. Typische Auflagen in diesem Sinne sind z. B., dass der Erbe zur Grafpflege verpflichtet ist oder die Auflage, Teile der Erbschaft für bestimmte Zwecke zu verwenden oder in einem bestimmten Sinne zu nutzen.
Ausgleichspflicht für Abkömmlinge
Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind Abkömmlinge, also in erster Linie Kinder, die aufgrund gesetzlicher Erbfolge – also dann, wenn kein Testament hinterlassen wurde – zur Erbfolge gelangen, verpflichtet, dasjenige, was sie von dem Erblasser zu dessen Lebzeiten als Ausstattung erhalten haben, bei der Auseinandersetzung untereinander zur Ausgleichung zu bringen, es sei denn, dass der Erblasser bei der Zuwendung etwas Anderes angeordnet hat. Ähnliches gilt für Zuschüsse zur Ausbildung, wenn sie ein bestimmtes Maß übersteigen sowie für Zuwendungen, bei denen der Erblasser die Ausgleichung ausdrücklich angeordnet hat.
Diese Vorschrift beruht auf der Vermutung des Gesetzgebers, dass ein Erblasser sein Vermögen unter seinen Abkömmlingen gleichmäßig verteilen wollte. Sie gilt daher nicht bei Vorhandensein eines Testaments, da dort anzunehmen ist, dass der Erblasser dies bei Testamentserrichtung entsprechend berücksichtigt hätte.
Aus dieser Vorschrift heraus rühren oft familiäre Streitigkeiten unter den Kindern, so dass entsprechende Forderungen an Miterben bei gesetzlicher Erbfolge erst nach kompetenter rechtlicher Beratung erfolgen sollten.
Ausschlagung der Erbschaft
Sie müssen eine Erbschaft, sei es aufgrund gesetzlicher Erbfolge oder kraft Testament, nicht annehmen. Sie können eine Erbschaft auch ausschlagen.
Hierbei ist zu beachten, dass der Erbe die Erbschaft nicht mehr ausschlagen kann, wenn er diese ausdrücklich oder „konkludent“ angenommen hat (Siehe Kapitel: Annahme der Erbschaft) oder, wenn die für die Ausschlagung vorgeschriebene Frist verstrichen ist.
Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen von dem Zeitpunkt an gerechnet, in welchem der Erbe von dem Anfall der Erbschaft und dem Grunde der Berufung Kenntnis erlangt. Ist der Erbe durch Verfügung von Todes wegen – Testament, Erbvertrag, letztwillige Verfügung – berufen, so beginnt die Frist nicht vor der Verkündung der Verfügung, d. h. in der Regel mit der Testamentseröffnung.
Die Frist zur Erbausschlagung beträgt sechs Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder wenn der Erbe sich zu Beginn der Frist im Ausland aufhält.
Die Erbausschlagung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht und ist zur Niederschrift durch das Nachlassgericht oder in öffentlicher beglaubigter Form (vor dem Notar) abzugeben.
Da eine Erbausschlagung insbesondere bei einer Überschuldung des Nachlasses in Betracht kommt oder in dem Fall, dass ein geringer Erbanteil ausgeschlagen werden soll, um stattdessen den Pflichtteil geltend zu machen, ist in all diesen Fällen eine rechtliche Beratung im Hinblick auf die Fristen unverzüglich angezeigt.
B
Berliner Testament
Bei dem sogenannten Berliner Testament handelt es sich um ein gemeinschaftliches Testament von Ehegatten, das handschriftlich oder vor einem Notar errichtet werden kann.
Es handelt sich zwar um die häufigste Testamentsform bei Ehegatten, hat aber insbesondere dann in erbschaftsteuerlicher Sicht gravierende Nachteile, wenn Vermögen zur Vererbung ansteht, das oberhalb der erbsteuerlichen Freibeträge liegt (Siehe auch Erbschaftsteuer ABC).t;/p>
Auch wenn nachstehend ein einfaches Muster abgedruckt ist, sollten Ehegatten zumindest dann ein Berliner Testament nach nachstehendem Muster nicht ohne vorherige rechtliche und/oder steuerliche Beratung errichten, wenn unter den Erben Streit droht, oder bei Vorhandensein von Vermögen oberhalb der steuerlichen Freibeträge. Diese können auch schon bei Vorhandensein von Haus- und Grundbesitz erschöpft sein.
MUSTER
Unser Testament
1. Wir setzen uns gegenseitig zu alleinigen Erben ein.
2. Erben des Längstlebenden von uns sollen unsere gemeinsamen Kinder Andreas und Markus – zu gleichen Teilen – sein, ersatzweise deren Abkömmlinge.
3. Sollte einer unserer Abkömmlinge nach dem Tode des Erstversterbenden von uns seinen Pflichtteil verlangen, so sollen er und seine Abkömmlinge auch vom Nachlass des Zuletztversterbenden von uns nur den Pflichtteil erhalten.
Ort, Datum, Unterschrift beider Ehegatten
Bestattung
Der Erblasser hat das Recht, den Bestattungsort und die Bestattungsart frei zu wählen. Nach geltender Rechtsprechung haben die Angehörigen diesen Willen zu beachten.
Nur für den Fall, dass der Erblasser selbst keine Erklärungen dazu hinterlassen hat, entscheiden die nächsten Angehörigen darüber, wie und wo der Erblasser bestattet wird. Dabei hat der Ehegatte des Verstorbenen ein Vorrecht vor allen übrigen Verwandten.
Wer ganz sicher gehen möchte, sollte bereits zu Lebzeiten ein Bestattungsunternehmen aufsuchen und den Bestattungsmodus abklären sowie hierzu ggf. entsprechende Verträge abschließen.
Damit sichergestellt ist, dass die Erben diese Verträge auch beachten, sollten Sie in Ihrem Testament entsprechende Anordnungen machen und ggf. auch eine Fotokopie hiervon dem Bestattungsinstitut aushändigen, damit die Erben nicht später andere Bestattungsmöglichkeiten auswählen.
Die Kosten einer standesgemäßen Beerdigung sind vom Erbe zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für die Beerdigung selbst, die Grabstätte und des Grabsteines, die üblichen Feierlichkeiten sowie Todesanzeigen.
E
Eigenhändiges Testament
Der Erblasser kann nach den Vorschriften des BGB ein Testament durch eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Dabei soll er angeben, zu welcher Zeit und an welchem Ort er es niedergeschrieben hat. Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten.
Absolut zwingend sind daher die eigenhändige Niederschrift und Unterschrift. Die Verwendung von Schreibmaschine, Computer oder Vordrucken ist damit unzulässig und machen das Testament nichtig.
Die Unterschrift soll aus Vor- und Zunamen bestehen. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise, z. B. „Eure Oma“, so reicht dies nur aus, wenn an der Urheberschaft des Testaments durch die Oma und auch an der Ernsthaftigkeit der Erklärung keine Zweifel bestehen.
Um derartigen Unsicherheiten von vornherein zu begegnen, sollte ein privatschriftlich errichtetes Testament daher grundsätzlich folgende Merkmale ausweisen:
lt;p>- eigenhändig geschrieben
– eigenhändig unterschrieben mit Vor- und Zuname sowie Ort und Datum
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner, und nur diese, können ein gemeinschaftliches eigenhändiges Testament errichten. Hierzu muss einer der Ehegatten oder Lebenspartner das Testament in der vorstehend näher bezeichneten Form errichten und der andere eigenhändig mit unterzeichnen sowie hierbei Ort und Datum angeben.
Erbrecht (gesetzliches)
– Abkömmlinge
Gesetzliche Erben der I. Ordnung und damit vor allen anderen Verwandten erbberechtigt sind die Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder, Enkel, Urenkel, usw. Wenn die Kinder beim Erbfall des Erblassers leben, schließen sie etwa bereits vorhandene Enkel und Urenkel von der Erbfolge aus.
Sind mehrere Kinder vorhanden, so erben sie zu gleichen Teilen.
An die Stelle eines bereits vorverstorbenen Kindes treten dessen Abkömmlinge, also die Enkel des Erblassers. Diese teilen sich – zu gleichen Teilen – den Erbanteil, den das vorverstorbene Kind erhalten hätte.
– Ehegatten
Voraussetzung für das Erbrecht des Ehegatten ist, dass der überlebende Ehegatte beim Erbfall mit dem Erblasser verheiratet war und dieser weder die Scheidung beantragt, noch ihr zugestimmt hatte.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhält der Ehegatte neben Verwandten der I. Ordnung (Abkömmlinge) 1/4 Anteil, neben Verwandten der II. Ordnung (Eltern, Geschwister, usw.) oder neben Großeltern 1/2 Anteil.
Also nur dann, wenn – ohne Testament – der Erblasser neben seinem Ehegatten keine weiteren Verwandten, wie Abkömmlinge, Eltern, Geschwister und deren Kinder, noch Großeltern hinterlässt, erhält der überlebende Ehegatte die gesamte Erbschaft allein.
Für die Höhe des Erbteils kommt es ferner darauf an, in welchem Güterstand die Ehegatten beim Todes des Erblassers gelebt haben.
Seit dem 01.07.1958 gilt als gesetzlicher Güterstand, d. h. wenn nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart wurde, die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Wird dieser Güterstand durch Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der vorstehend näher bezeichnete Erbteil neben Verwandten jeweils um 1/4 der Erbschaft erhöht.
Tatsächlich erhält der überlebende Ehegatte daher im Güterstand der Zugewinngemeinschaft:
– neben Verwandten der I. Ordnung 1/2 Anteil
– neben Verwandten der II. Ordnung sowie Großeltern 3/4 Anteil.
Diese Regelung gilt nicht, wenn die Ehegatten Gütertrennung vereinbart hatten. In diesem Fall erhält der überlebende Ehegatte:
– neben einem Kind 1/2 Anteil der Erbschaft
– neben zwei Kindern 1/3 Anteil der Erbschaft
– neben drei oder mehr Kindern 1/4 Anteil der Erbschaft.
– Lebensgefährte
Gesetzliche Erbansprüche, also ohne Bedenkung in einem Testament, haben nur Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner.
Ohne die Errichtung eines entsprechenden Testaments zugunsten des Lebensgefährten geht dieser also im Todesfall „leer“ aus.
– Lebenspartner
Zwei Personen gleichen Geschlechts, die vor der zuständigen Behörde eine eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem LPartG begründet haben, werden vom Gesetz nunmehr wie Ehegatten behandelt.
Dies gilt insbesondere für die gesetzliche Erbfolge (siehe Ehegatte), die Vorschriften über die Errichtung einer Verfügung von Todes wegen und den Pflichtteilsanspruch.
– Nichteheliche Kinder
Während nichteheliche Kinder nach dem Tode ihrer Mutter schon immer „voll“ erbberechtigt waren, gilt dies seit dem 01.04.1998 auch nach dem Tode des Vaters des nichtehelichen Kindes. Seit dem Inkrafttreten des Erbrechtsgleichstellungsgesetzes (ErbGleichG) mit Wirkung zum 01.04.1998 erbt ein nichteheliches Kind, welches nach dem 30.06.1949 geboren ist, wie ein eheliches Kind, d. h., es hat volles gesetzliches Erbrecht wie ein in der Ehe geborenes Kind ohne jede Einschränkungen.
Nichtehelichen Kindern, die vor dem 30.06.1949 geboren sind, steht hingegen an Stelle seines gesetzlichen Erbteils nur ein Erbersatzanspruch (in Geld) gegen den oder die Erben in Höhe seines Erbteils zu.
Erbauseinandersetzung
Sind an einer Erbschaft mehrere Personen beteiligt, spricht man von einer Erbengemeinschaft. Diese ist eine Gemeinschaft zur gesamten Hand, d. h., bis zur Erbauseinandersetzung ist der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen.
Keiner der Erben kann für sich allein über einzelne Nachlassgegenstände verfügen.
Im Hinblick darauf sind Erbengemeinschaften in der Regel bestrebt, sich so schnell wie möglich über den Nachlass auseinanderzusetzen.
In der Gestaltung der Erbauseinandersetzung sind die Miterben frei. So ist es z. B. möglich, einem der Erben etwaigen Grundbesitz zu Alleineigentum zu übertragen, während andere Miterben das Barvermögen oder sonstigen Nachlass erhalten.
Bei Wertverschiebungen ist es auch möglich, dass ein Miterbe an die anderen Miterben Ausgleichszahlungen dafür entrichtet, dass er einen größeren Vermögensgegenstand aus der Erbmasse erhält.
Sind sich die Miterben daher einig, kann die Erbauseinandersetzung ohne weiteres vollzogen werden. Gehört zum Nachlass Grundbesitz, ist dieser Vertrag allerdings vor einem Notar zu schließen.
Mit Abschluss des Erbauseinandersetzungsvertrages sowie der danach vollzogenen Teilung des Nachlasses ist die Erbengemeinschaft aufgelöst. Jeder der Miterben kann nunmehr allein über die ihm zugeteilten Nachlassgegenstände verfügen.
Kommt eine Einigung unter den Miterben nicht zustande, was leider recht häufig der Fall ist, kann das Nachlassgericht auf Antrag eines der Miterben die Teilung vermitteln.
Kommt es auch hierbei nicht zu einer Einigung unter den Miterben, bleibt nur noch der Prozessweg offen. Ein Miterbe kann einen Teilungsplan aufstellen und die übrigen Miterben auf Durchführung der Teilung verklagen.
Da es auf der Hand liegt, dass sich derartige Verfahren oft jahrelang hinziehen, kann an dieser Stelle nur nochmals die Mahnung ausgesprochen werden, den Erben durch Errichtung eines klaren und rechtlich einwandfreien Testamentes derartigen Streit und Mühen zu ersparen.
Aus steuerlicher Sicht ist zu beachten, das die Durchführung einer Erbauseinandersetzung dann erhebliche einkommensteuerrechtliche Folgen haben kann, wenn dabei auch eine Auseinandersetzung über „Betriebsvermögen“ erfolgt. Es können dadurch, je nach Gestaltung und Situation, gewinnmindernd „Anschaffungskosten“ oder auch – steuerpflichtige – „Veräußerungsgewinne“ entstehen.
Derartige Auseinandersetzungsverträge sollten daher nur nach vorheriger kompetenter rechtlicher und steuerlicher Beratung abgeschlossen werden, um ungewollte Folgen zu vermeiden.
Erbausschlagung
Sie müssen eine Erbschaft, sei es aufgrund gesetzlicher Erbfolge oder kraft Testament, nicht annehmen. Sie können eine Erbschaft auch ausschlagen.
Hierbei ist zu beachten, dass der Erbe die Erbschaft nicht mehr ausschlagen kann, wenn er diese ausdrücklich oder „konkludent“ angenommen hat (Siehe Kapitel: Annahme der Erbschaft) oder, wenn die für die Ausschlagung vorgeschriebene Frist verstrichen ist.
Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen von dem Zeitpunkt an gerechnet, in welchem der Erbe von dem Anfall der Erbschaft und dem Grunde der Berufung Kenntnis erlangt. Ist der Erbe durch Verfügung von Todes wegen – Testament, Erbvertrag, letztwillige Verfügung – berufen, so beginnt die Frist nicht vor der Verkündung der Verfügung, d. h. in der Regel mit der Testamentseröffnung.
Die Frist zur Erbausschlagung beträgt sechs Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder wenn der Erbe sich zu Beginn der Frist im Ausland aufhält.
Die Erbausschlagung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht und ist zur Niederschrift durch das Nachlassgericht oder in öffentlicher beglaubigter Form (vor dem Notar) abzugeben.
Da eine Erbausschlagung insbesondere bei einer Überschuldung des Nachlasses in Betracht kommt oder in dem Fall, dass ein geringer Erbanteil ausgeschlagen werden soll, um stattdessen den Pflichtteil geltend zu machen, ist in all diesen Fällen eine rechtliche Beratung im Hinblick auf die Fristen unverzüglich angezeigt.
Erbeinsetzung
Bei der Errichtung eines Testamentes ist es wichtig, in diesem klar und deutlich jemand zu seinem Erben einzusetzen. Da mit dem Tode einer Person dessen Vermögen als Ganzes auf eine oder mehrere Personen übergeht, können als Erben tatsächlich nur „Personen“ oder „juristische Personen“ eingesetzt werden, nicht etwa ein Tier.
Von der Erbeinsetzung ist die sogenannte Vermächtniseinsetzung zu unterscheiden. Im Falle der Erbeinsetzung ist der Erbe Rechtsnachfolger des Erblassers. Die Aussetzung eines Vermächtnisses an eine Person, z. B. „Fritz soll meine goldene Taschenuhr erhalten“, begründet nur eine Forderung des so Bedachten an den Beschwerten, in der Regeln den Erben. (siehe auch: Vermächtnis im Testament).
Erbengemeinschaft
Sind an einer Erbschaft mehrere Personen beteiligt, spricht man von einer Erbengemeinschaft. Diese ist eine Gemeinschaft zur gesamten Hand, d. h., bis zur Erbauseinandersetzung ist der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen.
Keiner der Erben kann für sich allein über einzelne Nachlassgegenstände verfügen.
Im Hinblick darauf sind Erbengemeinschaften in der Regel bestrebt, sich so schnell wie möglich über den Nachlass auseinanderzusetzen.
In der Gestaltung der Erbauseinandersetzung sind die Miterben frei. So ist es z. B. möglich, einem der Erben etwaigen Grundbesitz zu Alleineigentum zu übertragen, während andere Miterben das Barvermögen oder sonstigen Nachlass erhalten.
Bei Wertverschiebungen ist es auch möglich, dass ein Miterbe an die anderen Miterben Ausgleichszahlungen dafür entrichtet, dass er einen größeren Vermögensgegenstand aus der Erbmasse erhält.
Sind sich die Miterben daher einig, kann die Erbauseinandersetzung ohne weiteres vollzogen werden. Gehört zum Nachlass Grundbesitz, ist dieser Vertrag allerdings vor einem Notar zu schließen.
Mit Abschluss des Erbauseinandersetzungsvertrages sowie der danach vollzogenen Teilung des Nachlasses ist die Erbengemeinschaft aufgelöst. Jeder der Miterben kann nunmehr allein über die ihm zugeteilten Nachlassgegenstände verfügen.
Kommt eine Einigung unter den Miterben nicht zustande, was leider recht häufig der Fall ist, kann das Nachlassgericht auf Antrag eines der Miterben die Teilung vermitteln.
Kommt es auch hierbei nicht zu einer Einigung unter den Miterben, bleibt nur noch der Prozessweg offen. Ein Miterbe kann einen Teilungsplan aufstellen und die übrigen Miterben auf Durchführung der Teilung verklagen.
Da es auf der Hand liegt, dass sich derartige Verfahren oft jahrelang hinziehen, kann an dieser Stelle nur nochmals die Mahnung ausgesprochen werden, den Erben durch Errichtung eines klaren und rechtlich einwandfreien Testamentes derartigen Streit und Mühen zu ersparen.
Erbschein
Der Erbschein ist ein amtliches Zeugnis des Nachlassgerichts, welches bescheinigt, wer wen mit welchem Anteil oder allein beerbt hat. Er geniest „öffentlichen Glauben“, d. h. seine Richtigkeit und Vollständigkeit wird gesetzlich vermutet.
Bei testamentarischer Erbfolge wird der Erbschein nach Maßgabe des Testamentes erteilt, vorausgesetzt, dass dieses formgültig und gesetzlich einwandfrei errichtet war.
Ist keine letztwillige Verfügung vorhanden, weist der Erbschein den oder die Erben kraft gesetzlicher Erbfolge aus.
Antragsberechtigt für den Erbschein sind in erster Linie der Erbe oder einer der Miterben. Der Erbschein kann zu Protokoll des Nachlassgerichts oder eines Notars beantragt werden.
Erbvertrag
Neben dem privatschriftlichen Testament und dem öffentlichen Testament gibt es auch die Möglichkeit, einen Erbvertrag abzuschließen. Der Erbvertrag ist, wie es schon das Wort zum Ausdruck bringt, eine in Vertragsform errichtete Verfügung von Todes wegen, mit der ein Erblasser zugunsten des anderen Vertragsschließenden oder eines Dritten letztwillig bindend verfügt.
Der Unterschied zu einem gemeinschaftlichen Testament etwa liegt darin, dass die Erklärungen in dem Erbvertrag zunächst grundsätzlich unwiderruflich sind, d. h. der Erblasser kann seine letztwilligen Verfügungen in dem Erbvertrag ohne Zustimmung des anderen Vertragsschließenden nicht einseitig widerrufen, es sei denn, dass der Erbvertrag dem Erblasser ein entsprechendes einseitiges Rücktrittsrecht einräumt.
Ist dieses jedoch nicht vereinbart worden, kann der Erbvertrag nur durch eine neue Vereinbarung beider Vertragspartner wieder aufgehoben werden.
Der Erbvertrag bietet sich deshalb insbesondere dann an, wenn die Vertragspartner nicht verheiratet sind und deshalb kein gemeinschaftliches Testament errichten können, oder, wenn an dem Erbvertrag mehrere Personen mitwirken sollen, z. B. die Kinder, die aus Anlass der Erbeinsetzung Gegenverpflichtungen übernehmen, z. B. Hege und Pflege oder anderes.
Zu beachten ist allerdings, dass der Erblasser durch den Abschluss des Erbvertrages nur in seiner Testierfähigkeit beschränkt wird. Durch den Erbvertrag ist er jedoch nicht daran gehindert, noch zu Lebzeiten frei über sein Vermögen zu verfügen. Der Vertragserbe erhält also nur das Vermögen, welches beim Tode des Erblassers auch tatsächlich noch vorhanden ist.
Eröffnung eines Testamentes
Wer sich als Erbe gegenüber Banken, Versicherungen und Behörden ausweisen will, benötigt in der Regel das Testament des Erblassers mit dem sogenannten „Eröffnungsprotokoll“ über die Eröffnung des Testaments durch das zuständige Nachlassgericht.
Hierzu ist das Testament direkt oder über einen Rechtsanwalt oder Notar an das zuständige Nachlassgericht einzureichen, verbunden mit dem Antrag, das Testament zu eröffnen.
Dem Antrag ist eine Sterbeurkunde des Erblassers beizufügen sowie die Namen und Anschriften der gesetzlichen Erben sowie – falls der Testamentsinhalt bekannt ist – auch die Anschriften der testamentarischen Erben.
Das Nachlassgericht bestimmt hiernach einen sogenannten „Eröffnungstermin“, zu dem die gesetzlichen und testamentarischen Erben geladen werden. Erscheinen diese zu dem Termin nicht, erhalten sie vom Nachlassgericht schriftlich Kenntnis über den Inhalt des Testaments.
Durch die Einsicht in das Testament soll allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben werden, die Rechtsgültigkeit der letztwilligen Verfügung zu überprüfen. Ferner beginnen mit der Bekanntgabe des eröffneten Testaments diverse Fristen zu laufen, z. B. Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs, Erbausschlagung oder Verjährung.
Wer sich in einem Testament übergangen fühlt, dessen Echtheit oder Richtigkeit anzweifelt, sollte unverzüglich nach Erhalt des eröffneten Testaments rechtlichen Rat einholen.
Ersatzerbschaft
Nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im Erbrecht kann der Erblasser in seiner letztwilligen Verfügung eine sogenannte Ersatzerbschaft anordnen, die dann eintritt, wenn ein vorgesehener Erbe vor oder nach dem Eintritt des Erbfalls wegfällt.
Der typische Fall in Testamenten ist, dass darin zunächst die eigenen Kinder als Erben eingesetzt werden, ersatzweise (falls diese vorversterben) deren Kinder, also die Enkelkinder.
Der Ersatzerbe tritt direkt an die Stelle eines anderen und wird nur Erbe, wenn der zunächst Berufene nicht Erbe geworden ist, z. B. weil er vorverstorben ist.
G
Gemeinschaftliches Testament
Gemeinschaftliche Testamente können nur von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern gleichen Geschlechts errichtet werden. Nichteheliche Lebensgefährten können diese Testamentsform nicht wählen, sondern müssen Einzeltestamente oder einen Erbvertrag errichten.
Ein gemeinschaftlich errichtetes Testament von Ehegatten oder Lebenspartnern kann grundsätzlich nur gemeinsam wieder aufgehoben werden, z. B. durch gemeinsame Vernichtung, gemeinsames Widerrufstestament oder eine neue, anderslautende Verfügung.
Beabsichtigt nur einer der Ehegatten oder Lebenspartner, z. B. wegen aufgekommenem Streit oder Trennung, ein gemeinschaftliches Testament zu Lebzeiten gegenüber dem anderen zu widerrufen, so kann dies nur in Form notarieller Beurkundung erfolgen.
Nach dem Tode eines der Ehegatten werden sogenannten wechselbezügliche Verfügungen, z. B. „Nach dem Tode des Letztversterbenden soll unser gemeinsamer Sohn Max Alleinerbe sein“, des anderen unwiderruflich, es sei denn, dass das Testament einseitige Änderungen oder durch den überlebenden Ehepartner oder Lebenspartner auch nach dem Todes des Erstversterbenden von beiden ausdrücklich vorsieht.
Ansonsten kann der Überlebende nur widerrufen, wenn er alles ihm Zugewendete ausschlägt.
Wegen der bisweilen schwierigen Beurteilung in solchen Fällen sollte vor derartigen Maßnahmen immer erst Rechtsrat durch einen kompetenten Rechtsanwalt oder Notar eingeholt werden.
Geschieden und Testament
Geschiedene vergessen oft, dass die gemeinsamen Kinder auch nach der Scheidung mit dem Geschiedenen verwandt bleiben. Wird z. B. Vermögen an Kinder aus geschiedenen Ehen vererbt und diese Kinder versterben, z. B. aufgrund Unfalltod, vorzeitig ohne selbst verheiratet gewesen zu sein oder eigene Kinder zu hinterlassen, würden über diesen Umweg die Erbanteile wieder an den Geschiedenen fallen, da dieser das Kind als anderer Elternteil beerbt.
Wer das verhindern will, muss rechtzeitig ein Testament errichten, das diese Auswirkungen vermeidet.
Da eine derartige Gestaltung für Laien nicht einfach ist, sollten Sie für diesen Fall rechtlichen Rat einholen.
Gesetzliche Erbfolge
Bei gesetzlicher Erbfolge, also ohne Hinterlassung eines Testaments, wird der Erblasser von seinem Ehegatten und seinen Verwandten beerbt.
Die Erbfolge der Verwandten richtet sich dabei nach sogenannten Ordnungen, bei denen grundsätzlich gilt, dass ein Verwandter solange nicht zur Erbfolge berufen ist, solange noch ein Verwandten einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist. Beispiel: Kinder, Enkel, Urenkel (Ordnung I), schließen etwa noch vorhandene Eltern (Ordnung II) von der Erbfolge aus.
Innerhalb einer Ordnung schließen die jeweils nächsten Verwandten die weiteren Verwandten derselben Ordnung aus.
Beispiel: Enkel erben nicht, wenn die Kinder noch leben.
– Gesetzliches Erbrecht der Verwanden
I. Ordnung: Abkömmlinge (Kinder, Enkel, Urenkel, usw.)
II. Ordnung: Eltern und deren Abkömmlinge (Eltern, Geschwister, Neffen und Nichten, usw.)
III. Ordnung: Großeltern und deren Abkömmlinge (Großeltern, Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen usw.)
IV., V. Ordnung: Urgroßeltern, Voreltern und deren Abkömmlinge
Kinder erben zu gleichen Teilen. Ist ein Kind bereits vorverstorben, wächst dieser Anteil nicht etwa seinen Geschwistern an, sondern geht auf dessen Kinder (Enkel des Erblassers) über.
Bei den anderen Ordnungen „splittet“ sich das Erbe je Eltern-/Großelternteil usw., d. h.:
Ein Erblasser, der nicht verheiratet war und auch keine Abkömmlinge hinterlässt, wird im Todesfall von seinen beiden Eltern je zur Hälfte beerbt. Ist ein Elternteil bereits vorverstorben, erbt der noch lebende Elternteil nicht allein, sondern die Hälfte des vorverstorbenen Elternteils geht auf die Geschwister des Erblassers über, wobei mehrere Geschwister wieder zu gleichen Teilen erben (Beispiel: Noch lebende Mutter 1/2 Anteil, zwei Geschwister je 1/4 Anteil).
– Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten
Voraussetzung für das Erbrecht des Ehegatten ist, dass der überlebende Ehegatte beim Erbfall mit dem Erblasser verheiratet war und dieser weder die Scheidung beantragt, noch ihr zugestimmt hatte.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhält der Ehegatte neben Verwandten der I. Ordnung (Abkömmlinge) 1/4 Anteil, neben Verwandten der II. Ordnung (Eltern, Geschwister, usw.) oder neben Großeltern 1/2 Anteil.
Also nur dann, wenn – ohne Testament – der Erblasser neben seinem Ehegatten keine weiteren Verwandten, wie Abkömmlinge, Eltern, Geschwister und deren Kinder, noch Großeltern hinterlässt, erhält der überlebende Ehegatte die gesamte Erbschaft allein.
Für die Höhe des Erbteils kommt es ferner darauf an, in welchem Güterstand die Ehegatten beim Tode des Erblassers gelebt haben.
Seit dem 01.07.1958 gilt als gesetzlicher Güterstand, d. h. wenn nicht durch Ehevertrag etwas Anderes vereinbart wurde, die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Wird dieser Güterstand durch Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der vorstehend näher bezeichnete Erbteil neben Verwandten jeweils um 1/4 der Erbschaft erhöht.
Tatsächlich erhält der überlebende Ehegatte daher im Güterstand der Zugewinngemeinschaft:
– neben Verwandten der I. Ordnung 1/2 Anteil
– neben Verwandten der II. Ordnung sowie Großeltern 3/4 Anteil.
Diese Regelung gilt nicht, wenn die Ehegatten Gütertrennung vereinbart hatten. In diesem Fall erhält der überlebende Ehegatte:
– neben einem Kind 1/2 Anteil der Erbschaft
– neben zwei Kindern 1/3 Anteil der Erbschaft
– neben drei oder mehr Kindern 1/4 Anteil der Erbschaft.
Gewillkürte Erbfolge
Die „gewillkürte Erbfolge“ ist das Gegenbeispiel zur gesetzlichen Erbfolge. Hier beruht de Erbfolge auf dem „Willen des Erblassers“, ist also „gewillkürt“.
Dieses Recht räumt der Gesetzgeber dem Erblasser in den Vorschriften des BGB ausdrücklich ein und bringt damit den Vorrang der „gewillkürten Erbfolge“ vor der gesetzlichen Erbfolge zum Ausdruck.
Damit ist klargestellt, dass die gesetzliche Erbfolge durch eine letztwillige Verfügung des Erblassers ausgeschlossen wird und nur „zweitrangig“ ist.
Nach den gesetzlichen Vorschriften hat der Erblasser hierbei folgende Möglichkeiten:
– Er kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen – Testament, Erbvertrag, letztwillige Verfügung – den oder die Erben bestimmen.
– Er kann dabei einen Verwandten oder den Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen.
– Er kann hierbei einem anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen, ein Vermögensvorteil = Vermächtnis zuwenden.
– Er kann hierbei dem Erben oder Vermächtnisnehmer zu einer Leistung verpflichten, ohne einem anderen ein Recht auf die Leistung zuzuwenden – Auflage im Testament.
– Er hat das Recht, durch Vertrag einen Erben einzusetzen sowie Vermächtnisse und Auflagen anordnen – Erbvertrag.
Grundbuchberichtigung
Hat ein Erblasser auch Haus- und Grundbesitz hinterlassen, muss das Grundbuch berichtigt und der oder die Erben als neuer Eigentümer eintragen werden.
Der Antrag kann von dem Erben formlos schriftlich gestellt werden.
Zum Nachweis der Erbfolge ist bei gesetzlicher Erbfolge sowie bei Vorhandensein eines nur privatschriftlich errichteten Testamentes zusätzlich ein Erbschein beizufügen.
Hat der Erblasser ein notarielles Testament errichtet, aus welchem sich die Erbfolge klar erkennen lässt, reicht hier in der Regel die Vorlage dieses Testamentes nebst Protokoll über die Testamentseröffnung durch das zuständige Nachlassgericht aus.
Befindet sich der Grundbesitz an demselben Ort wie das zuständige Nachlassgericht, kann das Grundbuchamt auch zum Zwecke der Prüfung der Erbfolge gebeten werden, die Akten des Nachlassgerichtes beizuziehen.
Güterstand (im Erbfall)
Für die Höhe des Erbteils kommt es darauf an, in welchem Güterstand die Ehegatten beim Tode des Erblassers gelebt haben.
Seit dem 01.07.1958 gilt als gesetzlicher Güterstand, d. h. wenn nicht durch Ehevertrag etwas Anderes vereinbart wurde, die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Wird dieser Güterstand durch Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der vorstehend näher bezeichnete Erbteil neben Verwandten jeweils um 1/4 der Erbschaft erhöht.
Tatsächlich erhält der überlebende Ehegatte daher im Güterstand der Zugewinngemeinschaft:
– neben Verwandten der I. Ordnung 1/2 Anteil
– neben Verwandten der II. Ordnung sowie Großeltern 3/4 Anteil.
Diese Regelung gilt nicht, wenn die Ehegatten Gütertrennung vereinbart hatten. In diesem Fall erhält der überlebende Ehegatten:
– neben einem Kind 1/2 Anteil der Erbschaft
– neben zwei Kindern 1/3 Anteil der Erbschaft
– neben drei oder mehr Kindern 1/4 Anteil der Erbschaft.
Gütertrennung (im Erbfall)
Bestand beim Erbfall unter den Eheleuten „Gütertrennung“, so gelten für den überlebenden Ehegatten abweichende Erbanteile bei gesetzlicher Erbfolge, also ohne Testament, da sich der Erbanteil des überlebenden Ehegatten nicht um 1/4 Anteil aus dem Ausgleich des Zugewinns erhöht.
Bei vereinbarter Gütertrennung, die auch für den Erbfall gelten soll, erhält der überlebende Ehegatte:
– neben einem Kind 1/2 Anteil der Erbschaft
– neben zwei Kindern 1/3 Anteil der Erbschaft
– neben drei oder mehr Kindern 1/4 Anteil der Erbschaft.
L
Lebensgefährte im Erbrecht
Gesetzliche Erbansprüche, also ohne Bedenkung in einem Testament, haben nur Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner.
Ohne die Errichtung eines entsprechenden Testaments zugunsten des Lebensgefährten geht dieser also im Todesfall „leer“ aus.
Lebenspartner im Erbrecht
Zwei Personen gleichen Geschlechts, die vor der zuständigen Behörde eine eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem LPartG begründet haben, werden vom Gesetz nunmehr wie Ehegatten behandelt.
Dies gilt insbesondere für die gesetzliche Erbfolge (siehe Ehegatte), die Vorschriften über die Errichtung einer Verfügung von Todes wegen und den Pflichtteilsanspruch.
Letztwillige Verfügung
Unter diesem Begriff werden alle Verfügungsarten des Erblassers zusammengefasst, die die Erbfolge nach seinem Ableben regeln.
Man spricht in diesem Fall von „gewillkürter Erbfolge“.
Die „gewillkürte Erbfolge“ ist das Gegenbeispiel zur gesetzlichen Erbfolge. Hier beruht de Erbfolge auf dem „Willen des Erblassers“, ist also „gewillkürt“.
Dieses Recht räumt der Gesetzgeber dem Erblasser in den Vorschriften des BGB ausdrücklich ein und bringt damit den Vorrang der „gewillkürten Erbfolge“ vor der gesetzlichen Erbfolge zum Ausdruck.
Damit ist klargestellt, dass die gesetzliche Erbfolge durch eine letztwillige Verfügung des Erblassers ausgeschlossen wird und nur „zweitrangig“ ist.
Nach den gesetzlichen Vorschriften hat der Erblasser hierbei folgende Möglichkeiten:
– Er kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen – Testament, Erbvertrag, letztwillige Verfügung – den oder die Erben bestimmen.
– Er kann dabei einen Verwandten oder den Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen.
– Er kann hierbei einem anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen, ein Vermögensvorteil = Vermächtnis zuwenden.
– Er kann hierbei dem Erben oder Vermächtnisnehmer zu einer Leistung verpflichten, ohne einem anderen ein Recht auf die Leistung zuzuwenden – Auflage im Testament.
– Er hat das Recht, durch Vertrag einen Erben einzusetzen sowie Vermächtnisse und Auflagen anordnen – Erbvertrag.
N
Nacherbschaft
Die sogenannte Vor- und Nacherbschaft unterscheidet sich von der sogenannten Vollerbschaft darin, dass Vor- und Nacherben denselben Erblasser beerben.
Im Gegensatz zur „Vollerbschaft“ erbt der sogenannte Nacherbe erst dann, wenn ein anderer bereits vor ihm (Vor-)Erbe der Erbschaft derselben Person war.
Bei der sogenannten Vor- und Nacherbschaft gelten für den Vorerben im Gegensatz zur Vollerbschaft diverse gesetzliche Beschränkungen zugunsten des Nacherben, die sicherstellen sollen, dass das Erbe dem Nacherben auch erhalten bleibt und nicht – wie etwa bei einer Vollerbschaft möglich – von dem Erben „verschleudert“ wird.
Zu diesem Zweck werden in einem Testament oder Erbvertrag eine oder mehrere Personen als Vorerben eingesetzt. Der Nacherbe hingegen erhält die Erbschaft erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. mit dem Todes des Vorerben, dessen Wiederverheiratung oder anderen bestimmbaren Ereignissen.
Der Vorerbe unterliegt gesetzlichen Beschränkungen, auch wenn es das Gesetz zulässt, ihn von bestimmten Beschränkungen zu befreien. In diesem Fall spricht man von einem „befreiten Vorerben“.
In der Regel unterliegt der Vorerbe zugunsten des Nacherben insbesondere folgenden Beschränkungen.
– Er kann über Grundstücke und Grundstücksrechte nicht ohne Zustimmung des Nacherben verfügen. Geschieht dies trotzdem, was im Normalfall faktisch schon an dem eingetragenen „Nacherbenvermerk“ im Grundbuch scheitert, so sind seine Verfügungen beim späteren Nacherbfall dem Nacherben gegenüber unwirksam.
– Der Vorerbe kann, mit Ausnahme von „Anstandsschenkungen“, keine unentgeltlichen Verfügungen vornehmen, also z. B. einen großen Wertgegenstand des Nachlasses verschenken. Von dieser Einschränkung kann auch der Erblasser den Vorerben nicht befreien.
Auch wenn die Vor- und Nacherbschaft in juristischer Hinsicht bestimmte Vorteile zur Sicherung des Nachlasses für Nacherben bietet, ist ein wesentlicher Nachteil die doppelte Besteuerung mit Erbschaftsteuer.
Bei größerem Vermögen oberhalb der erbschaftsteuerlichen Freibetträge sollte daher vor der Anordnung immer auch ein Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht hinzugezogen werden.
Notarielles Testament
Dem notariellen Testament, auch „öffentliches Testament“ genannt, gebührt gegenüber dem eigenhändig, privatschriftlich errichteten Testament grundsätzlich der Vorrang.
Durch die Mitwirkung des Notars wird sichergestellt, dass der letzte Wille des Erblassers einen rechtlich einwandfreien Ausdruck im Testament findet und unverständliche oder gar rechtlich unzulässige Anordnungen in dem Testament vermieden werden.
Darüber hinaus sind bei einem notariellen Testament auch die späteren Anfechtungsmöglichkeiten erschwert, da der Notar schon kraft seiner allgemeinen Prüfungspflicht die Geschäfts- und Testierfähigkeit des Erblassers zu prüfen hat.
Auch mit dem Vorwurf der „Testamentsfälschung“ kann ein notarielles Testament nicht angegriffen werden.
Der Erblasser muss sich auch nicht um die Verwahrung seines Testamentes kümmern, da der Notar das Testament unverzüglich in die sogenannte besondere amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht zu geben hat.
Wer die entstehenden Kosten scheut, sei unter „Gesamtbetrachtungsweise“ darauf hingewiesen, dass das notarielle Testament letztlich sogar Kosten erspart, wenn später zum Nachweis der Erbfolge ein Erbschein benötigt wird.
Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Erblasser Haus- und Grundbesitz hinterlässt, es sei denn, dass die Erben ein eröffnetes notarielles Testament vorlegen können.
Ein gemeinschaftliches privates Testament, welches die Erbfolge nach dem Erstversterbenden und dem Zuletztversterbenden der Ehegatten regelt, verursacht zweimal die amtliche Testamentseröffnungsgebühr sowie auch zweimal die Kosten für den Erbschein.
Bei einem notariellen Testament reicht hingegen in der Regel die Testamentseröffnung aus, wenn in diesem Testament die Erben klar und deutlich bezeichnet sind, was durch die Mitwirkung des Notars oder vorheriger anwaltlicher Beratung sichergestellt sein dürfte.
In diesem Fall wird das eröffnete notarielle Testament in aller Regel vom Grundbuchamt, Banken, Versicherungen und Behörden als Erbnachweis anerkannt, ohne dass es des weiteren Erbscheinsverfahrens bedarf.
P
Pflichtteil
– Pflichtteilsanspruch
Der sogenannte Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsanspruch nach den Vorschriften des BGB schränkt die Testierfähigkeit des Erblassers in gewisser Weise ein.
Dabei ist auch von Bedeutung, dass der Pflichtteilsanspruch nur in wenigen Ausnahmefällen, z. B. Misshandlungen des Erblassers oder „kriminellen Handlungen“, entzogen werden kann.
Bei „normalen“ Familienverhältnissen dürften die Pflichtteilsansprüche durch Testament ausgeschlossener Erben daher bestehen bleiben.
Das entsprechende Gesetz lautet:
– Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen.
– Das gleiche Recht steht den Eltern und dem Ehegatten des Erblassers zu, wenn sie durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind.
Pflichtteilsberechtigt sind also der Ehegatte, die Abkömmlinge (Kinder, auch nichteheliche Kinder sowie Enkel, usw.) und die Eltern, nicht etwa auch noch Geschwister oder entferntere Verwandte.
Der Pflichtteilsanspruch steht immer nur dem nächsten Verwandten zu. Enkelkinder und Eltern sind daher nicht pflichtteilsberechtigt, wenn Kinder vorhanden sind, die den Pflichtteil verlangen könnten, auch wenn sie es nicht tun.
Der Pflichtteilsanspruch wird für den oder die Berechtigten durch Ausschluss von der Erbfolge durch Verfügung von Todes wegen begründet.
Pflichtteilsberechtigt ist also nur, wer den Erblasser aufgrund gesetzlicher Erbfolge ohne Vorhandensein des ihn beeinträchtigenden Testaments beerbt hätte.
Der Pflichtteilsanspruch selbst ist nur ein „Geldanspruch“. Der Berechtigte kann von dem Erben die Zahlung eines Betrages verlangen, der in seiner Höhe dem Wert des halben, auf ihn entfallenden, gesetzlichen Erbanteils entspricht.
Einen Erbanspruch, und damit Anspruch auf die Nachlassgegenstände selbst, hat der Pflichtteilsberechtigte nicht.
Beispiele: a) Ehegatten setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein. Es ist ein Kind vorhanden. Bei Versterben des Vaters oder der Mutter hat dieses Kind gegen den überlebenden Elternteil (im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft) einen Pflichtteilsanspruch von 1/4 des Geldwertes des Nachlasses, da es ohne Testament zu 1/2 geerbt hätte.
b) Der Verstorbene hinterlässt drei Kinder, hat durch Testament jedoch nur zwei der Kinder als Erben je zur Hälfte eingesetzt und damit das dritte Kind „praktisch“ enterbt. Bei gesetzlicher Erbfolge würde jedes Kind 1/3 Anteil erben. Das „enterbte“ Kind hat daher einen Pflichtteilsanspruch von 1/6 Anteil.
– Pflichtteilsergänzungsanspruch
Für die Berechnung des Anspruchs spielt der sogenannte Pflichtteilsergänzungsanspruch eine große Rolle.
Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. Eine verbrauchbare Sache kommt dabei mit dem Werte in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. Ein anderer Gegenstand kommt mit dem Werte in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat; hatte er zur Zeit der Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur dieser in Ansatz gebracht.
Die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt.
Beispiel: Der Erblasser stirbt sechs Jahre nach der Schenkung. Dann werden für die Berechnung des Anspruchs noch 40 % des Wertes der Schenkung in Ansatz gebracht.
Sind zehn Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe, d. h.: Bestand die Ehe noch beim Erbfall, ist die Schenkung mit vollem Wert zu berücksichtigen!
– Geltendmachung des Pflichtteils
Der Pflichtteilsanspruch muss von dem Berechtigten gegenüber dem oder den Erben geltend gemacht werden, unter Umständen auch gegen einen Beschenkten.
Mehrere Erben tragen die Pflichtteilslast in der Regel im Verhältnis ihrer Erbanteile.
Nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung verjährt der Pflichtteilsanspruch in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Pflichtteilsberechtigte von dem Eintritt des Erbfalls und der ihn beeinträchtigenden Verfügung Kenntnis erlangt, ohne Kenntnis nach 30 Jahren.
Privatschriftliches Testament
Der Erblasser kann nach den Vorschriften des BGB ein Testament durch eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Dabei soll er angeben, zu welcher Zeit und an welchem Ort er es niedergeschrieben hat. Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten.
Absolut zwingend sind daher die eigenhändige Niederschrift und Unterschrift. Die Verwendung von Schreibmaschine, Computer oder Vordrucken ist damit unzulässig und machen das Testament nichtig.
Die Unterschrift soll aus Vor- und Zunamen bestehen. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise, z. B. „Eure Oma“, so reicht dies nur aus, wenn an der Urheberschaft des Testaments durch die Oma und auch an der Ernsthaftigkeit der Erklärung keine Zweifel bestehen.
Um derartigen Unsicherheiten von vornherein zu begegnen, sollte ein privatschriftlich errichtetes Testament daher grundsätzlich folgende Merkmale ausweisen:
– eigenhändig geschrieben
– eigenhändig unterschrieben mit Vor- und Zuname sowie Ort und Datum
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner, und nur diese, können ein gemeinschaftliches eigenhändiges Testament errichten. Hierzu muss einer der Ehegatten oder Lebenspartner das Testament in der vorstehend näher bezeichneten Form errichten und der andere eigenhändig mit unterzeichnen sowie hierbei Ort und Datum angeben.
R
Rücknahme eines Testamentes
– privatschriftliches Testament
Zu beachten ist, dass ein privatschriftliches Testament, welches zur Aufbewahrung in die besondere amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht gegeben wurde, mit der Rücknahme aus der Verwahrung nicht „automatisch“ erlischt.
Wenn ein privatschriftliches Testament nicht mehr gültig sein soll, also „zurückgenommen“ werden soll, ist es zu vernichten oder durch ein späteres Testament zu widerrufen.
– notarielles Testament
Ein notarielles Testament muss vom Notar grundsätzlich in die besondere amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht gegeben werden.
Wird dieses vom Erblasser, bei gemeinschaftlichen Testamenten von beiden Eheleuten oder Lebenspartnern, aus der amtlichen Verwahrung zurückgenommen, gilt das notarielle Testament automatisch als widerrufen.
Wer hiernach vermeiden will, dass nach seinem Ableben die gesetzliche Erbfolge eintritt, muss auf jeden Fall ein neues Testament errichten.
T
Teilungsanordnung im Testament
Nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften hat der Erblasser die Möglichkeit, in einer letztwilligen Verfügung eine sogenannte Teilungsanordnung zu treffen.
Damit kann der Erblasser bestimmen, wie die von ihm eingesetzten Erben den Nachlass untereinander aufzuteilen haben.
So kann der Erblasser einzelne Nachlassgegenstände bestimmten Miterben zuweisen. Er kann aber auch den gesamten Nachlass unter den Miterben aufteilen, sodass die Erben die Teilungsanordnung nur noch vollziehen müssen.
Die Teilungsanordnung ist von der Vermächtniseinsetzung zu unterscheiden. Bei der Vermächtniseinsetzung – siehe Vermächtnis im Testament – wird einem bestimmten Bedachten nur ein bestimmter Vermögenswert zugedacht, während bei einer Teilungsanordnung der Nachlass unter den Erben aufzuteilen ist.
Testament errichten
– privatschriftliches Testament
Der Erblasser kann nach den Vorschriften des BGB ein Testament durch eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Dabei soll er angeben, zu welcher Zeit und an welchem Ort er es niedergeschrieben hat. Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten.
Absolut zwingend sind daher die eigenhändige Niederschrift und Unterschrift. Die Verwendung von Schreibmaschine, Computer oder Vordrucken ist damit unzulässig und machen das Testament nichtig.
Die Unterschrift soll aus Vor- und Zunamen bestehen. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise, z. B. „Eure Oma“, so reicht dies nur aus, wenn an der Urheberschaft des Testaments durch die Oma und auch an der Ernsthaftigkeit der Erklärung keine Zweifel bestehen.
Um derartigen Unsicherheiten von vornherein zu begegnen, sollte ein privatschriftlich errichtetes Testament daher grundsätzlich folgende Merkmale ausweisen.
– eigenhändig geschrieben
– eigenhändig unterschrieben mit Vor- und Zuname sowie Ort und Datum
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner, und nur diese, können ein gemeinschaftliches eigenhändiges Testament errichten. Hierzu muss einer der Ehegatten oder Lebenspartner das Testament in der vorstehend näher bezeichneten Form errichten und der andere eigenhändig mit unterzeichnen sowie hierbei Ort und Datum angeben.
– notarielles Testament
Ein notarielles, oder auch „öffentliches“ Testament genannt, wird zur Niederschrift eines Notars in der Form errichtet, in dem der Erblasser seinen letzten Willen mündlich erklärt oder dem Notar eine Schrift mit der Erklärung übergibt, dass die Schrift seinen letzten Willen enthalte.
Der Regelfall ist, dass ein Erblasser mündlich zu Protokoll des Notars seinen letzten Willen erklärt.
Die Übergabe einer Schrift, die „offen“, aber auch „verschlossen“ sein kann, hat nur eine untergeordnete Bedeutung. Insbesondere vor der Übergabe einer „verschlossenen“ Schrift wird gewarnt, da der Notar in diesem Fall zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, den Erblasser über den Inhalt zu befragen und ihn auf mögliche rechtliche Bedenken hinzuweisen.
Testament widerrufen
– privatschriftliches Testament
Zu beachten ist, dass ein privatschriftliches Testament, welches zur Aufbewahrung in die besondere amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht gegeben wurde, mit der Rücknahme aus der Verwahrung nicht „automatisch“ erlischt.
Wenn ein privatschriftliches Testament nicht mehr gültig sein soll, also „zurückgenommen“ werden soll, ist es zu vernichten oder durch ein späteres Testament zu widerrufen.
– notarielles Testament
Ein notarielles Testament muss vom Notar grundsätzlich in die besondere amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht gegeben werden.
Wird dieses vom Erblasser, bei gemeinschaftlichen Testamenten von beiden Eheleuten oder Lebenspartnern, aus der amtlichen Verwahrung zurückgenommen, gilt das notarielle Testament automatisch als widerrufen.
Wer hiernach vermeiden will, dass nach seinem Ableben die gesetzliche Erbfolge eintritt, muss auf jeden Fall ein neues Testament errichten.
Testamentseröffnung
Wer sich als Erbe gegenüber Banken, Versicherungen und Behörden ausweisen will, benötigt in der Regel das Testament des Erblassers mit dem sogenannten „Eröffnungsprotokoll“ über die Eröffnung des Testaments durch das zuständige Nachlassgericht.
Hierzu ist das Testament direkt oder über einen Rechtsanwalt oder Notar an das zuständige Nachlassgericht einzureichen, verbunden mit dem Antrag, das Testament zu eröffnen.
Dem Antrag ist eine Sterbeurkunde des Erblassers beizufügen sowie die Namen und Anschriften der gesetzlichen Erben sowie – falls der Testamentsinhalt bekannt ist – auch die Anschriften der testamentarischen Erben.
Das Nachlassgericht bestimmt hiernach einen sogenannten „Eröffnungstermin“, zu dem die gesetzlichen und testamentarischen Erben geladen werden. Erscheinen diese zu dem Termin nicht, erhalten sie vom Nachlassgericht schriftlich Kenntnis über den Inhalt des Testaments.
Durch die Einsicht in das Testament soll allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben werden, die Rechtsgültigkeit der letztwilligen Verfügung zu überprüfen. Ferner beginnen mit der Bekanntgabe des eröffneten Testaments diverse Fristen zu laufen, z. B. Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs, Erbausschlagung oder Verjährung.
Wer sich in einem Testament übergangen fühlt, dessen Echtheit oder Richtigkeit anzweifelt, sollte unverzüglich nach Erhalt des eröffneten Testaments rechtlichen Rat einholen.
Testamentsvollstreckung
Bei größeren Vermögen oder dann, wenn die Erben zahlreich, zerstritten, unerfahren oder möglicherweise noch minderjährig sind, kann es sinnvoll sein, im Testament eine Testamentsvollstreckung anzuordnen.
Dieses Recht wird dem Erblasser in den gesetzlichen Vorschriften des BGB ausdrücklich eingeräumt.
Wenn der Erblasser nichts anderes verfügt, hat der Testamentsvollstrecker die Aufgabe, die letztwilligen Verfügungen des Erblassers zur Ausführung zu bringen, den Nachlass zu verwalten oder bei mehreren Erben die Auseinandersetzung über den Nachlass unter ihnen vorzunehmen.
Gerade im unternehmerischen Bereich, insbesondere zur Sicherung des Lebenswerks eines Familienunternehmens, kann die Testamentsvollstreckung eine gute Möglichkeit sein, für eine kontinuierliche Weiterführung zu sorgen.
Der Testamentsvollstrecker ist nur der letztwilligen Verfügung und den hierzu ergangenen gesetzlichen Bestimmungen unterworfen.
Für seine Tätigkeit erhält der Testamentsvollstrecker in der Regel ein Honorar, das vorher vom Erblasser in der letztwilligen Verfügung festgelegt ist oder später vom Nachlassgericht festgesetzt wird.
Im privaten Bereich kann es sich häufig auch um eine „ehrenamtliche Tätigkeit“ unter Freunden handeln.
Die Testamentsvollstreckung endet, wenn die dem Testamentsvollstrecker zugewiesenen Aufgaben erledigt sind, spätestens jedoch 30 Jahre nach dem Erbfall.
Bei größerem Vermögen, insbesondere im unternehmerischen Bereich, zahlreichen, zerstrittenen oder unerfahrenen Erben ist es sinnvoll, zum Testamentsvollstrecker eine rechtlich versierte Person zu bestellen.
Da die in der DANSEF organisierten Rechtsanwälte, die häufig gleichzeitig auch Fachanwälte für Erbrecht, Familienrecht und/oder Steuerrecht sind, für die Übernahme des Testamentsvollstreckeramtes besonders geeignet sind und über Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen., regen wir an, aus dem Kreise unserer Mitglieder anhand unserer Expertendaten einen geeigneten Testamentsvollstrecker auszuwählen.
Testierfähigkeit
Testierfähig ist nach den gesetzlichen Bestimmungen derjenige, der hierfür die entsprechenden Anforderungen erfüllt.
Wer volljährig und voll geschäftsfähig ist, kann sowohl ein privatschriftliches, als auch ein notarielles Testament errichten.
Ein Minderjähriger kann ein Testament errichten, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat, jedoch nur vor einem Notar.
Wer wegen Geisteskrankheit, Demenz oder ähnlichem nicht in der Lage ist die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen oder zu erfassen, kann ein Testament nicht errichten.
In Zweifelsfällen sollte daher immer ein notarielles Testament, am besten noch unter Hinzuziehung eines Arztes, verfasst werden.
Todeserklärung
Es kommt, auch als Nachwirkung des zweiten Weltkrieges, immer noch vor, dass Familienangehörige vermisst oder verschollen sind.
In den Fällen des zweiten Weltkrieges besitzen die Familienangehörigen häufig schriftliche Erklärungen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht oder des Deutschen Roten Kreuzes, dass der Verschollene oder Vermisste zuletzt an einem bestimmten Ort gesehen wurde und vermutlich aufgrund von Kriegseinwirkungen verstoben ist.
Solche Erklärungen reichen als Ersatz für eine Sterbeurkunde, insbesondere im Erbscheinsverfahren, nicht aus.
Der Todesnachweis kann in solchen Fällen nur durch einen Todeserklärungsbeschluss nach dem Verschollenheitsgesetz geführt werden.
Zuständig ist hierfür das Amtsgericht, in welchem der für zu Tod Erklärende zuletzt seinen Wohnsitz hatte oder der Wohnsitz des Antragstellers.
Da sich derartige Verfahren gegebenenfalls manchmal auch Jahre hinziehen können, kann allen Erblassern, in deren Familienkreis Vermisste oder Verschollene existieren, nur dringend empfohlen werden, ein Testament zu errichten, damit die anderen Familienangehörigen nicht später mit den erheblichen Schwierigkeiten der Urkundenbeschaffung für das Erbscheinsverfahren zu kämpfen haben.
U
Unterschied zwischen einem privaten und einem notariellen Testament
Dem notariellen Testament, auch „öffentliches Testament“ genannt, gebührt gegenüber dem eigenhändig, privatschriftlich errichteten Testament grundsätzlich der Vorrang.
Durch die Mitwirkung des Notars wird sichergestellt, dass der letzte Wille des Erblassers einen rechtlich einwandfreien Ausdruck im Testament findet und unverständliche oder gar rechtlich unzulässige Anordnungen in dem Testament vermieden werden.
Darüber hinaus sind bei einem notariellen Testament auch die späteren Anfechtungsmöglichkeiten erschwert, da der Notar schon kraft seiner allgemeinen Prüfungspflicht die Geschäfts- und Testierfähigkeit des Erblassers zu prüfen hat.
Auch mit dem Vorwurf der „Testamentsfälschung“ kann ein notarielles Testament nicht angegriffen werden.
Der Erblasser muss sich auch nicht um die Verwahrung seines Testamentes kümmern, da der Notar das Testament unverzüglich in die sogenannte besondere amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht zu geben hat.
Wer die entstehenden Kosten scheut, sei unter „Gesamtbetrachtungsweise“ darauf hingewiesen, dass das notarielle Testament letztlich sogar Kosten erspart, wenn später zum Nachweis der Erbfolge ein Erbschein benötigt wird.
Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Erblasser Haus- und Grundbesitz hinterlässt, es sei denn, dass die Erben ein eröffnetes notarielles Testament vorlegen können.
Ein gemeinschaftliches privates Testament, welches die Erbfolge nach dem Erstversterbenden und dem Zuletztversterbenden der Ehegatten regelt, verursacht zweimal die amtliche Testamentseröffnungsgebühr sowie auch zweimal die Kosten für den Erbschein.
Bei einem notariellen Testament reicht hingegen in der Regel die Testamentseröffnung aus, wenn in diesem Testament die Erben klar und deutlich bezeichnet sind, was durch die Mitwirkung des Notars oder vorheriger anwaltlicher Beratung sichergestellt sein dürfte.
In diesem Fall wird das eröffnete notarielle Testament in aller Regel vom Grundbuchamt, Banken, Versicherungen und Behörden als Erbnachweis anerkannt, ohne dass es des weiteren Erbscheinsverfahrens bedarf.
V
Vermächtnis im Testament
Der Erblasser kann durch Testament einem anderen, ohne ihn dabei als Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil zuwenden.
Dies nennt man Vermächtnis.
Durch die Vermächtniseinsetzung wird der so Bedachte nicht zum Erben. Die Einsetzung begründet nur eine Forderung des Bedachten = Vermächtnisnehmer gegen den damit Beschwerten, in der Regel den oder die Erben.
Der Bedachte und der vermachte Gegenstand, z. B. Opas Taschenuhr, eine Briefmarkensammlung, o. ä., müssen im Testament klar bezeichnet sein.
Ferner muss für den Bedachten ein Vermögensvorteil vorliegen.
Dabei muss es sich nicht unbedingt um die Zuwendung eines wertvollen Gegenstandes handeln. Es kann auch eine Schuld erlassen werden.
Dringend wird hier vor einer Verwechslung von Vermächtnis- und Erbeinsetzung gewarnt.
Gerade eigenhändige, privatschriftliche Testamente enthalten häufig Aufzählungen des gesamten Besitzes, der dann bestimmten Personen zugeordnet wird.
Da hierin jedoch niemand ausdrücklich als Erbe bezeichnet wird, kann ein derartiges Testament dazu führen, dass die gesetzliche Erbfolge oder eine Erbfolge nach Quoten eintritt und alle so Bedachten ihr Forderungsrecht gegen die so durch das Nachlassgericht ermittelten Erben durchsetzen müssen.
Lassen Sie sich vor derartigen Vorhaben unbedingt erbrechtlich beraten, damit nach Ihrem Ableben auch tatsächlich das von Ihnen Gewollte eintritt.
Vorerbschaft
Die sogenannte Vor- und Nacherbschaft unterscheidet sich von der sogenannten Vollerbschaft darin, dass Vor- und Nacherben denselben Erblasser beerben.
Im Gegensatz zur „Vollerbschaft“ erbt der sogenannte Nacherbe erst dann, wenn ein anderer bereits vor im (Vor-)Erbe der Erbschaft derselben Person war.
Bei der sogenannten Vor- und Nacherbschaft gelten für den Vorerben im Gegensatz zur Vollerbschaft diverse gesetzliche Beschränkungen zugunsten des Nacherben, die sicherstellen sollen, dass das Erbe dem Nacherben auch erhalten bleibt und nicht – wie etwa bei einer Vollerbschaft möglich – von dem Erben „verschleudert“ wird.
Zu diesem Zweck werden in einem Testament oder Erbvertrag eine oder mehrere Personen als Vorerben eingesetzt. Der Nacherbe hingegen erhält die Erbschaft erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. mit dem Todes des Vorerben, dessen Wiederverheiratung oder anderen bestimmbaren Ereignissen.
Der Vorerbe unterliegt gesetzlichen Beschränkungen, auch wenn es das Gesetz zulässt, ihn von bestimmten Beschränkungen zu befreien. In diesem Fall spricht man von einem „befreiten Vorerben“.
In der Regel unterliegt der Vorerbe zugunsten des Nacherben insbesondere folgenden Beschränkungen.
– Er kann über Grundstücke und Grundstücksrechte nicht ohne Zustimmung des Nacherben verfügen. Geschieht dies trotzdem, was im Normalfall faktisch schon an dem eingetragenen „Nacherbenvermerk“ im Grundbuch scheitert, so sind seine Verfügungen beim späteren Nacherbfall dem Nacherben gegenüber unwirksam.
– Der Vorerbe kann, mit Ausnahme von „Anstandsschenkungen“, keine unentgeltlichen Verfügungen vornehmen, also z. B. einen großen Wertgegenstand des Nachlasses verschenken. Von dieser Einschränkung kann auch der Erblasser den Vorerben nicht befreien.
Auch wenn die Vor- und Nacherbschaft in juristischer Hinsicht bestimmte Vorteile zur Sicherung des Nachlasses für Nacherben bietet, ist ein wesentlicher Nachteil die doppelte Besteuerung mit Erbschaftsteuer.
Bei größerem Vermögen oberhalb der erbschaftsteuerlichen Freibetträge sollte daher vor der Anordnung immer auch ein Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht hinzugezogen werden.
Z
Zugewinngemeinschaft (im Erbfall)
Für die Höhe des Erbteils von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern kommt es darauf an, in welchem Güterstand die Ehegatten beim Tode des Erblassers gelebt haben.
Seit dem 01.07.1958 gilt als gesetzlicher Güterstand, d. h., wenn nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart wurde, die sogenannte Zugewinngemeinschaft.
Wird dieser Güterstand durch Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich die gesetzlichen Erbanteile neben Verwandten jeweils um 1/4 Anteil erhöhen.
Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, die diesen gesetzlichen Güterstand beibehalten haben, erhalten daher im Erbfall, wenn kein Testament vorliegt, bei gesetzlicher Erbfolge einschließlich dieses Ausgleichsviertels
– neben Verwandten der I. Ordnung: 1/2 Anteil
– neben Verwanden der II. Ordnung sowie Großeltern: 3/4 Anteil